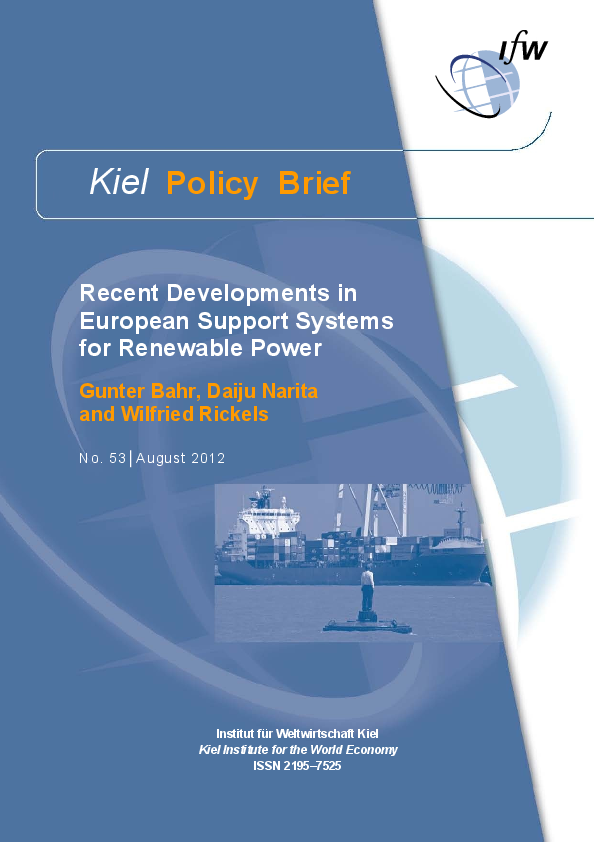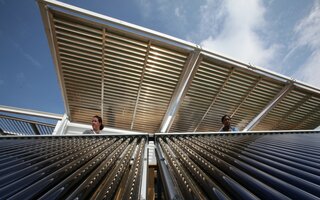Wirtschaftspolitischer Beitrag
Recent Developments in European Support Systems for Renewable Power
Autoren
Erscheinungsdatum
Schlagworte
Europa
Klima
Natürliche Ressourcen
Ein zentrales Ziel der europäischen Energie- und Umweltpolitik ist die verstärkte Bereitstellung von Strom aus erneuerbaren Energien. In ihrem Beitrag untersuchen die Kieler Forscher Gunter Bahr, Daiju Narita und Wilfried Rickels alternative Instrumente zur Förderung erneuerbarer Energien. Neben der absoluten Höhe bei Förderung erneuerbarer Energien spielt insbesondere der Einfluss auf die Volatilität der Cash-Flows eine wichtige Rolle. Einspeisevergütungen reduzieren diese Volatilität und erlauben damit eine niedrige Vergütung pro Einheit Strom als das bei markt-basierten Systemen der Fall ist. Bei markt-basierten Systemen erfolgt die Förderung über den Handel von grünen Zertifikaten, die die Volatilität des Cash-Flows erhöhen, so dass Investoren eine höhere Risikoprämie verlangen. Allerdings ergibt sich durch die Festlegung der Gesamtmenge an erneuerbarem Strom ein geringeres Risiko im Hinblick auf die gesamten Förderkosten. Im Fall einer relativen flachen Kostenkurve für den Ausbau erneuerbarer Energien bleiben somit die gesamten Förderkosten niedrig, während bei der Einspeisevergütung in diesem Fall die gesamten Förderkosten sehr hoch sein können. Eine Möglichkeit, die Vorteile beider System zu kombinieren, ergibt sich durch die Anwendung so genannter Tender-Systeme, bei denen die Investoren die feste Einspeisevergütung in einem Bietverfahren ermitteln.